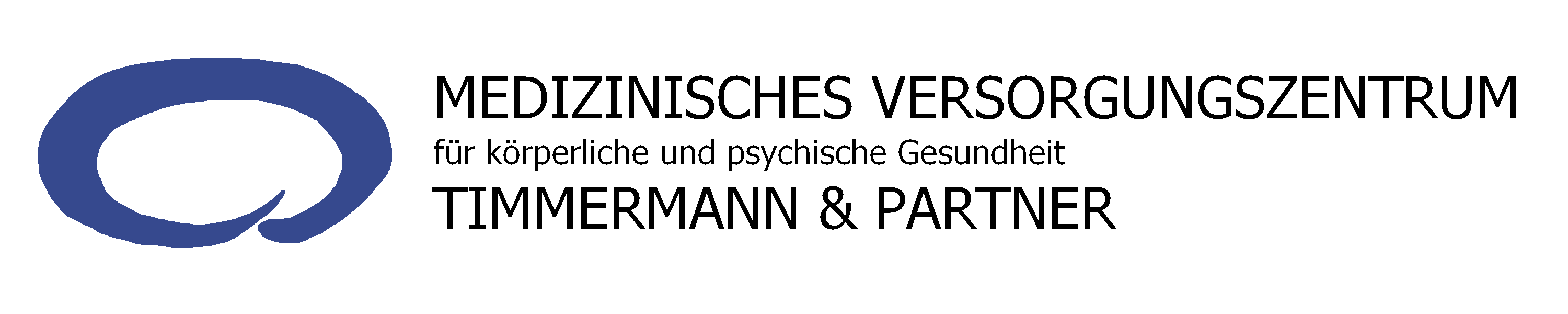Was tun bei einem Trauma oder einer Traumafolgestörung? Das Wort „Trauma“, Mehrzahl Traumata kommt aus dem Griechischen und steht für eine körperliche oder seelische Verletzung, Erschütterung oder Wunde. Eine Folge davon kann eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sein.
In diesem zweiten Thementeil beleuchtet Julia Behrendt, Ärztin in der Weiterbildung zur Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und in Ausbildung zu Psychotraumatherapie das Thema Trauma und die Therapiemöglichkeiten.
Für viele Flüchtlinge liegen traumatisierende Erlebnisse erst sehr kurz zurück und sind noch sehr stark präsent. Umgekehrt spüren Menschen, deren Traumata länger zurückliegen (z.B. ältere Menschen, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder miterleben mussten), vielleicht keinerlei Verbindung ihres damals erlittenen Traumas zum jetzigen Leidensdruck. Beispielsweise können auch unklare Symptome oder Schmerzen Folgen einer Traumatisierung sein.
Wichtigstes Kriterium ist eigentlich bei allen Menschen die Motivation für eine Therapie: „Ich spüre, dass ich unter etwas leide, und ich will, dass dieses Leiden aufhört.“
Beispiel
Ein Mann, Mitte 70, empfindet zeitlebens heftiges Unwohlsein, Atemnot und ein starkes Ekelgefühl in dichtgedrängten Menschenmengen. Er selbst weiß gar nicht warum und meidet ganz einfach Ansammlungen von Menschen oder Gruppenveranstaltungen. Als kleines Kind musste er während der nächtlichen Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs dicht gedrängt mit anderen, verängstigen Menschen in einem schlecht belüfteten Luftzschutzbunker sitzen – diese traumatischen Erlebnisse können erklären, warum der Mann bis heute eine automatisch ablaufende Stressreaktion erlebt, wo immer er sich von mehreren Menschen umgeben sieht, sei es im Fahrstuhl, an der Supermarktkasse oder in sonstigen, eigentlich alltäglichen Situationen. Für Flüchtlinge ist ein Trauma also unter Umständen besser zugänglich und damit besser behandelbar.
Welcher Behandlungsansatz der individuell Beste ist, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Um den jeweils besten Ansatz zu finden, arbeiten wir Hand in Hand, betrachten gemeinsam die Fallgeschichte eines Patienten aus verschiedenen Perspektiven, sein soziales Umfeld und den persönlichen Werdegang.
Wichtig sind die einzelnen Therapiephasen: Diese sind zunächst Stabilisierung, dann eventuell Konfrontation und schließlich Reintegration. Gruppenformate können insofern sehr erfolgreich sein, als dass mehrere Menschen schneller und mit weniger Wartezeit an hochwirksame Behandlungsmethoden gelangen können.
Autorin

Julia Behrendt, Ärztin am MVZ Timmermann und Partner, in der Weiterbildung zur Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und in Ausbildung zu Psychotraumatherapie